
Buchtipps

Hier eine kleine Auswahl von Büchern die mir beim Lesen Freude bereitet haben und die vielleicht nicht jeder kennt
Belletristik:
„Galgeninsel“ von Jakob Maria Soedher, Taschenbuchausgabe 2007, 240 Seiten, Verlag Edition Hochfeld, ISBN: 978-3-9810268-5-6
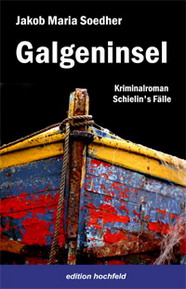 In
meiner Wahlheimat - Lindau am Bodensee - spielender Krimi über Mord, Rache und
undurchsichtige Immobilienspekulationen.
In
meiner Wahlheimat - Lindau am Bodensee - spielender Krimi über Mord, Rache und
undurchsichtige Immobilienspekulationen.
Eine stärke des Autors liegt zweifellos im erschaffen witzig-skurriler bis kauziger Figuren ohne diese zu überzeichnen – wie etwa seinem Hauptprotagonisten Kommissar Schielin, der seine Fälle mit seinem Esel (!) bespricht, den er nach einem französischen Dichter des 16. Jahrhunderts auf den Namen „Ronsard“ getauft hat.
Eine andere stärke besteht in der gelungenen und atmosphärisch dichten Darstellung der Stadt Lindau, das geht von der Nennung von Straßennamen bis hin zu stimmigen Ortsbeschreibungen, von der Nennung ansässiger Firmen und Gaststätten bis dazu, daß die Figuren die in Lindau beliebten Biermarken trinken und Kommissar Schielins Frau sich beruflich mit dem übersetzen technischer Handbücher beschäftigt - tatsächlich ist in Lindau eine Firma ansässig, die sich genau damit befasst.
Eine leichte und kurzweilige Lektüre die sich flüssig liest und langsam Spannung und Interesse aufbaut. Da verzeiht man auch kleine Logikfehler – mit welcher Begründung etwa gegen Ende des Buches Kommissar Schielin einen Verdächtigen wegen Verdachts der Vorteilsnahme und des Betruges festnimmt ist noch nachvollziehbar, wieso er diesen aber anscheinend auch des Mordes verdächtigte hat sich mir hingegen nicht ganz erschlossen. Richtige Beweise schien er jedenfalls nicht in der Hand zu haben. Bis der gute Kommissar dann den wahren Täter fassen kann ergeben sich aber eh noch einige Wendungen.
Aber wie
auch immer - das Buch hat beim Lesen spaß gemacht! Ein Bild der
Galgeninsel, einer winzigen Halbinsel bei Lindau, gibt es hier:

„Die Vermessung der Welt“ von Daniel Kehlmann, gebundene Ausgabe
2005, 304 Seiten, Rowohlt, ISBN: 3 4980 3528 2
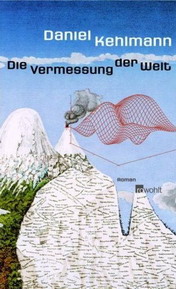 Auf
das Buch bin ich einfach deshalb neugierig geworden, weil es so lange die
Bestsellerlisten anführte. Es ist in mehrfacher Hinsicht erfrischend
ungewöhnlich geschrieben. Zum Beispiel ist der ganze Roman komplett in
indirekter Rede gehalten, woran man sich aber schnell gewöhnt und was vor allem
der Situationskomik zugute kommt.
Auf
das Buch bin ich einfach deshalb neugierig geworden, weil es so lange die
Bestsellerlisten anführte. Es ist in mehrfacher Hinsicht erfrischend
ungewöhnlich geschrieben. Zum Beispiel ist der ganze Roman komplett in
indirekter Rede gehalten, woran man sich aber schnell gewöhnt und was vor allem
der Situationskomik zugute kommt.
Der Autor beschreibt die parallelen Lebensgeschichten zweier deutscher Forscher,
des Forschungsreisenden Alexander von Humboldt und des Mathematik-Genies Carl
Friedrich Gauß,
die sich beide, obwohl sie ansonsten ungleicher nicht sein konnten, ganz Ihrer Wissenschaft
verschrieben hatten.
Aber es
geht nicht nur um diese beiden Personen, sondern auch um die Zeit in der sie lebten, die
Zeit der deutschen Klassik (die ordentlich durch den Kakao gezogen wird!), es
tauchen im Roman Personen wie Goethe, Schiller, Kant, Jefferson, sogar
„Turnvater“ Jahn und noch viele andere bekannte und auch weniger bekannte Namen
auf. Es macht spaß während des lesens in Lexikas nachzuschlagen, was es mit dem
ein oder anderen auf sich hat. So oder so ist „Die Vermessung der Welt“ einer
der wenigen Bücher nach deren Lektüre der Leser sich schlauer und gleichzeitig
gut unterhalten fühlt. Geistesgeschichte als Komödie – wie es der Autor Daniel
Kehlmann selbst in einem Interview sagte. Wobei ein gewisses Wissen über diese
Zeit von Vorteil ist, da man ansonsten einiges nicht verstehen könnte. Es ist
auch ein Roman über eine Zeit in der sich viel neues im Auf- und Umbruch befand,
neues in der Wissenschaft und der Politik. Damals neues, das uns heutigen aber
so selbstverständlich ist, das es gut tut einmal an andere Zeiten erinnert zu
werden.
Einer der Hauptkritikpunkte ist sicher, das Kehlmann viel Erfindet und der Leser
oft kaum weiß was noch Fakt und was schon Fiktion ist. Es ist ein Roman und
alles andere als eine exakte Biographie über die beiden Forscher, seine
Protagonisten werden sehr überspitzt dargestellt und Ihnen dinge in den Mund
gelegt, die diese vielleicht so nicht gesagt hätten. Aber Kehlmann tut das mit
viel Selbstironie, wenn er Gauß beispielsweise sagen lässt: „Seltsam sei es,
dass man in einer bestimmte Zeit geboren sei. Es verschaffe einem einen
unziemlichen Vorteil vor der Vergangenheit und mache einen zum Clown der
Zukunft. Jeder Dummkopf könne sich in 200 Jahren über ihn lustig machen und
absurden Unsinn über seine Person erfinden.“ Und dieser herrlich Augenzwinkernde
Humor zieht sich durch das ganze Buch.
"Der ewige Krieg" (Forever
War) von Joe Haldeman,
Erstveröffentlichung 1975, Taschenbuchausgabe 2000, 329 Seiten, Heyne Verlag,
ISBN 3453164148
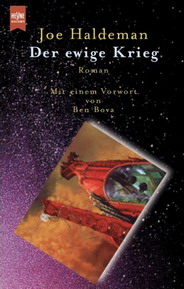
Ein Anti-Kriegsroman vom Schlage eines "Im Westen nichts neues" in
Science-Fiction Form? Ja das gibt es!
Der Autor Joe Haldeman konnte in seiner Lebensgeschichte einschlägige Erfahrung sammeln. 1943 in den USA geboren, studierte er Physik, Astronomie, Mathematik und Informatik bevor er 1967 zur US-Army eingezogen und nach Vietnam geschickt wurde. Es gab damals eine Quote für Akademiker, die ebenfalls eingezogen wurden. Der Autor kehrte nach seinem Wehrdienst in ein durch die 68er Bewegung kulturell verändertes Land zurück. Ähnlich erging es aber vielen Soldaten in vielen Kriegen.
Dem "Helden" seines Romans namens William Mandella widerfährt ganz ähnliches. Auch Er wird nach seinem Physik-Studium vom Militär eingezogen.
Man merkt das der Roman von einem Physiker geschrieben wurde, dem Phänomen der Zeitdilatation bei Reisen mit Lichtgeschwindigkeit, wird breiter Raum in dem Roman eingeräumt. Für die ausgeschickten Soldaten dauern Ihre Missionen nur Monate oder wenige Jahre, währenddessen auf der Erde Jahrzehnte vergehen, alle zurückgebliebenen Angehörigen und Freunde alt werden und die Heimat sich für die Heimkehrenden entfremdet. Durch diesen Kunstgriff kann der Autor seine persönlichen Erfahrungen auf die Spitze treiben und dem Leser mitteilen. Zum Schluss ist Soldat Mandella nur wenig gealtert, während für die Erde 1.100 (!) Jahre vergangen sind. Und - man hat es als Leser von Anfang an irgendwie geahnt - der ganze Konflikt um den sich alles gedreht hat war im Grunde völlig Sinnlos.
Während des Höhepunktes des Kalten Krieges und der (immer noch existenten, wenn auch aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwundenen) atomaren Bedrohung in der dieser Roman entstanden ist, war es eine weit verbreitete Annahme, das Sich die Menschheit rapide weiterentwickeln müsste, wenn Sie sich nicht selbst vernichten sollte. In seinem Roman hat Haldeman eine noch dazu spannende Geschichte konstruiert, in der es seinem Protagonisten möglich ist, eben diese Entwicklung selbst zu erleben.
Joe Haldeman erhielt für seinen Roman den Hugo Award sowie den Nebula Award - die beiden wohl bedeutendsten Auszeichnungen im Science-Fiction-Genre. Völlig zurecht, ich habe selten ein Science-Fiction-Buch gelesen, das so zum Nachdenken anregte - und eine wirklich schöne Liebesgeschichte gibt es noch obendrauf.
"Am Ende des Krieges" (Forever Free) von Joe Haldeman, Erstveröffentlichung 1999, Taschenbuchausgabe 2002, 316 Seiten, Heyne Verlag, ISBN 3-453-19672-4
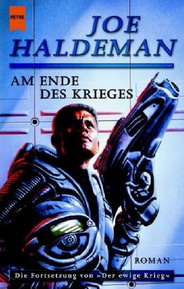
Es war eine große Überraschung, als der inzwischen am berühmten MIT (Massachusetts Institute of Technology) lehrende Joe Haldeman fast ein Vierteljahrhundert nach seinem Bestseller „Forever War“ (im deutschen "Der Ewige Krieg") die direkte Fortsetzung „Forever Free“ veröffentlichte. Im deutschen wurde daraus der Titel "Am Ende des Krieges". Der Originaltitel war allerdings passender, denn während sich der Vorgänger "Der ewige Krieg" um eben jenen drehte, hat "Am Ende des Krieges" die Freiheit als zentrales Thema.
Die meisten
überlebenden Veteranen wie die Hauptfiguren Mandella und seine Frau Marygay sind
auf einem abgelegenen und eher trostlosen Planeten angesiedelt worden, den sie "Middlefinger"
nennen, und können sich mit Ihrer Abhängigkeit zu dem "Menschen" nicht recht
anfreunden. Die Menschheit hatte sich nämlich zu einem Gruppenbewußtsein das aus
untereinander verbundenen Milliarden Exemplaren menschlicher Klone besteht
"weiterentwickelt". Die Veteranen hatten Sich hingegen das Ende des Krieges ein
wenig anders vorgestellt und fühlen sich nun unfrei und kontrolliert. Daher hat Mandella die Idee mit einer Gruppe Freiwilliger noch einmal mit einem
ausrangierten Sternenkreuzer in eine ungewisse Zukunft aufzubrechen.
Zwar kann die Geschichte bei weitem nicht die Eindringlichkeit des genialen
Vorgängers erreichen, aber noch immer versteht Haldeman sein Handwerk.
Der Rambo-Verschnitt mit der Mega-Wumme auf dem Cover sollte übrigens nicht
weiter stören – der Heyne Verlag ist dafür bekannt selbst den besten SF-Romanen
kitschige Cover zu verpassen, die nichts mit der Handlung zu tun haben.
"Lara Croft- Tomb Raider 2 - Der vergessene Kult" von Timothy Stahl und E. E. Knight, Oktober 2004, Dino Entertainment Verlag, ISBN 3833210850
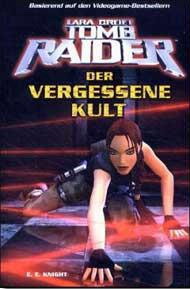 Ja, ein
Buch zu einem Computerspiel
Ja, ein
Buch zu einem Computerspiel
![]() - das ist natürlich nichts hochgeistiges, aber
vielleicht ein schöner "Urlaubsschmöker" und tatsächlich, nachdem ich die
Lektüre von „Lara Croft und der
Vergessene Kult" von E. E. Knight beendet hatte, war ich wirklich angenehm
überrascht. So angenehm das ich vor lauter Begeisterung gleich eine Rezension
auf amazon.de geschrieben habe, diese ist auch die Grundlage dieses Textes.
- das ist natürlich nichts hochgeistiges, aber
vielleicht ein schöner "Urlaubsschmöker" und tatsächlich, nachdem ich die
Lektüre von „Lara Croft und der
Vergessene Kult" von E. E. Knight beendet hatte, war ich wirklich angenehm
überrascht. So angenehm das ich vor lauter Begeisterung gleich eine Rezension
auf amazon.de geschrieben habe, diese ist auch die Grundlage dieses Textes.
Nach meinem Empfinden ist der zweite Band aus der Lara Croft Reihe der beste der
bisher erschienenen drei Bände. Sehr gut gefielen mir die vielen Anspielungen
auf die Spiele. Um ein paar Beispiele zu nennen: Als Lara ein neues
Waffensystem testet sagt Sie „Das hätte ich hinter der grünen Tür der Festung Strahov gebrauchen können". Also ich war höchst amüsiert, als ich diesen
kleinen
Insiderwitz gelesen habe. Sogar Pierre und Larson (bekannt aus TR1 und TR5)
kommen in einem kurzen Rückblick vor. Außerdem hat Winston, Ihr alter Diener,
ein paar Auftritte und Croft Manor wird genauso beschrieben, wie wir es aus den
Spielen kennen, die Geschichte des Geheimen Bunkers in dem Lara Ihre
Artefakt-Sammlung versteckt (bekannt aus dem Trainingslevel von TR3) wird
erzählt, sowie wie die Fresken in Ihrem Swimmingpool (bekannt aus TR2)
entstanden sind. Man hat durch die ganzen Anspielungen immer das Gefühl, genau
die Lara aus den Spielen vor sich zu haben, ganz anders also wie in den Filmen.
Es wird sich auch exakt an die Hintergrundgeschichte der Spiele gehalten. (Also
Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater, der Absturz im Himalaya, Ihr Internatsbesuch
etc). In der Biographie des Autors wird auch erwähnt, das er selbst gerne am
Computer spielt, also ich hatte hier das erste mal den Eindruck, das hier jemand
mal wirklich Ahnung von Lara hat. Auch als jemand, der alle Tomb Raider Spiele
von vorne bis hinten durchgespielt hat, konnte ich hier keine logischen Fehler
feststellen (wieder ganz im Gegensatz zu den Kino-Filmen).
Aber nicht nur der Lara-Background wurde sehr gut ausgearbeitet, auch die
restliche Hintergrundgeschichte hat einige Reize. Der Autor setzt den Trend
fort, die bekannten Theorien und Mythen von berühmten Parawissenschaftlern und
Romanautoren für seine eigenen Werke zu verwenden, so wie der derzeit
erfolgreichste Thriller-Autor Dan Brown für seine Werke die Bücher von Lincoln/Baigent/Leigh
ausschlachtet, oder so wie das PC-Adventure „Nibiru" die Theorien von Zecharias
Sitchin (so eine Art israelischer Erich von Däniken) als Hintergrund benutzt, so
benutzt E. E. Knight für seinen Lara-Roman die Romane des Horror-Autors H. P.
Lovecraft aus den 20er Jahren und den von Ihm geschaffenen "Cthulhu-Mythos". Es
ist ein amüsanter Wink mit dem Zaunpfahl, wenn der Autor einen „Gott aus der
Tiefe" in seinem Lara-Roman als „Uhluhtc" bezeichnet. Was Rückwärts gelesen ja
Cthulhu ergibt. Ansonsten verwendet E. E. Knight aber nicht nur Lovecraft als
Vorlage für seine Geschichte, nein auch die Theorien von Graham Hancock zum
Sirius und zur voreiszeitlichen Ur-Zivilisation fließen eindeutig in der
Geschichte mit ein als Lara auf die Forschungen Professor von Croys zur
Zivilisation von „Proto-Ur" stößt.
Also als Fazit kann ich nur sagen: ein tolles und empfehlenswertes Buch für alle
Freunde von Ms. Croft. Mit
massig Anspielungen auf die TR-Computerspiele, auf Klassiker des Horror-Romans
und parawissenschaftliche Theorien. Besonders natürlich für Tomb-Raider-Fans ein
echtes "Schmankerl"!
"Hüter der Pforten - Geschichten aus dem Cthulhu-Mythos" Taschenbuchausgabe 2005, 857 Seiten, Bastei-Lübbe Verlag, ISBN 3404770811
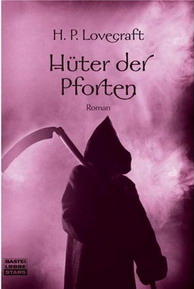 Wer
meine Rezension zu "Lara Croft- Tomb Raider 2 - Der vergessene Kult" gelesen
hat, weiß das ich ein Fan der Werke von Howard Phillips Lovecraft bin - Dem
Altmeister des Horrors. Die Wirkung der leider viel zu wenigen Geschichten die
der Autor vor seinem zu frühen Tod im Jahre 1937 schrieb, war auf das
Horror-Genre sehr einflussreich. Es ist daher kein Wunder das Lovecraft auch als
der Tolkien der Horror-Literatur bezeichnet wurde. Lovecraft schuf in seinen
Werken ein eigenes Universum, seinen eigenen Mythos, den sogenannten "Cthulhu-Mythos".
Eine sorgfältig konstruierte Geschichte vom Überleben und wirken eines
unvorstellbar alten und mächtigen Bösen das hinter unserer vordergründigen
Realität steht und vor dessen Hintergrund seine Geschichten spielen.
Wer
meine Rezension zu "Lara Croft- Tomb Raider 2 - Der vergessene Kult" gelesen
hat, weiß das ich ein Fan der Werke von Howard Phillips Lovecraft bin - Dem
Altmeister des Horrors. Die Wirkung der leider viel zu wenigen Geschichten die
der Autor vor seinem zu frühen Tod im Jahre 1937 schrieb, war auf das
Horror-Genre sehr einflussreich. Es ist daher kein Wunder das Lovecraft auch als
der Tolkien der Horror-Literatur bezeichnet wurde. Lovecraft schuf in seinen
Werken ein eigenes Universum, seinen eigenen Mythos, den sogenannten "Cthulhu-Mythos".
Eine sorgfältig konstruierte Geschichte vom Überleben und wirken eines
unvorstellbar alten und mächtigen Bösen das hinter unserer vordergründigen
Realität steht und vor dessen Hintergrund seine Geschichten spielen.
In dieser Anthologie wurden die Werke verschiedener, zum teil sehr namhafter, Autoren zusammengestellt, die sich des "Cthulhu-Mythos" bedienen. Die zeitliche Entstehung der 22 enthaltenen Geschichten reicht dabei von 1928 ("Cthulhus Ruf") bis 1979 ("Das Erstsemester"). Zwar sind nicht alle Geschichten gleich gut, aber es dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.
Die bekanntesten der Autoren sind wohl Robert Bloch (Der Autor von "Psycho" - die wenigsten werden sein Buch kennen, die meisten aber die Verfilmung von Alfred Hitchcock) und Robert E. Howard (Der Erfinder von Conan dem Barbaren). Diese beiden Autoren waren auch Brieffreunde von H. P. Lovecraft. Sogar vom allseits bekannten Stephen King stammt eine der Geschichten. Auch vom Großmeister Lovecraft selbst sind 2 Geschichten enthalten "Cthulus Ruf" und "Der leuchtende Trapezoeder", diese beiden Geschichten setzen sozusagen den Rahmen. Die Anordnung der Geschichten ist geschickt gewählt, da manche aufeinander Bezug nehmen, obwohl es doch alles in sich abgeschlossene Geschichten sind.
Meine
Lieblingsgeschichte ist: "Die Rückkehr der Lloigor" von Colin Wilson. Ein
amerikanischer Literaturprofesser und ein britischer Colonel kommen einer
versteckten Botschaft im (tatsächlich existenten) Voynich-Manuskript auf die
Spur, aber niemand schenkt ihrer Theorie von einer außerirdischen
Weltverschwörung Glauben (naja, außer eben den außerirdischen Lloigor selbst
![]() ).
).
Sachbücher:
"Zeitreisen am Bodensee - von den Rentierjägern zu den
Alemannen" von Anneros Troll und Jürgen Hald, 2004, Culturis-Verlag, ISBN
3000131175
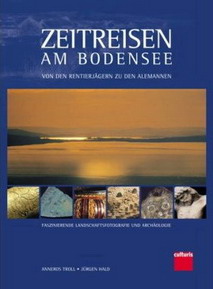 Ein
Führer zu den Stätten der Ur- und Frühgeschichte rund um den Bodensee.
Ein
Führer zu den Stätten der Ur- und Frühgeschichte rund um den Bodensee.
Von Fachleuten geschriebene Artikel zu den einzelnen Fundstätten und Sehenswürdigkeiten. Fundiert und doch leicht verständlich. Das ganze wird von hervorragenden Bildern illustriert.
Die Idee
für das Buch stammt von der Photographin Anneros Troll aus Steißlingen. Von Ihr
stammen auch die Bodenseephotographien in Form von 25 doppelseitigen Bildern,
die im Wechsel mit den archäologischen Funden präsentiert werden.
Mitherausgeber und -autor ist der Konstanzer Kreisarchäologe Dr. Jürgen Hald, der
mir von einigen hochinteressanten Vorträgen und Führungen her bekannt ist. Er
hat auch die redaktionelle Arbeit seiner 14 Archäologen-Kollegen aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz koordiniert, die Artikel zu
archäologischen Highlights aus den jeweiligen geografischen Gebieten rund um den
Bodensee für dieses Buch geschrieben haben.
Eine klare Empfehlung und ein Lesevergnügen für alle die sich für die Geschichte
des Bodensees interessieren.
"Eine kurze Geschichte von fast allem" von Bill Bryson, 2005, Goldmann-Verlag, ISBN 3442460719
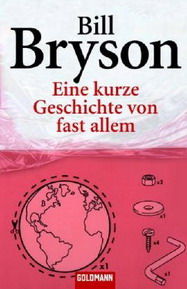
Der Autor ist ansonsten für seine witzigen Reiseerzählungen bekannt, wie z. Bsp. sein Buch "Picknick mit Bären" (im original viel passender: "in the woods") in dem er seine Erlebnisse auf dem Appalachian Trail, einem Fernwanderweg in den USA beschreibt.
Bei diesem Buch jedoch geht es um die Wissenschaftsgeschichte im Allgemeinen und die teilweise in der Rückschau irrwitzig anmutenden Wege die es brauchte um für die Menschheit neue Erkenntnisse zu erlangen. Wer weiß schon, daß z. Bsp. hinter den beiden für die Umwelt langfristig verheerenden Folgen der Verbleiung des Benzins (ursprünglich sollten die Bleizusätze die Klopfgeräusche des Motors verhindern) und der Verwendung von FCKWs als Kühlmittel in Kühlschränken ein und derselbe Wissenschafter steckte, der mit seinem untrüglichen Gespür für gefährliche Erfindungen schließlich auch selbst durch eine ebensolche umkam.